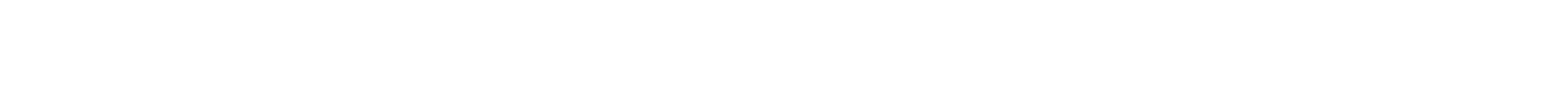Der „Teufel von Schiltach“ 1533
Dr. Hans Harter
April 2008

1 Die Ereignisse
Von den geschichtlich überlieferten, verheerenden Schiltacher Stadtbränden der Jahre 1511, 1533, 1590, 1791 und 1833 hat sich keiner so tief in das Gedächtnis der Zeitgenossen und Nachwelt eingegraben wie jener, der am Gründonnerstag, den 10. April 1533 das Städtchen heimsuchte. Zwar sind die damaligen Ereignisse durch keine Akten belegt, doch berichten Briefe, zwei verschiedene Flugschriften, ein Flugblatt (siehe Abbildung 1 auf Seite 4) sowie mehrere Chroniken in etwa gleichlautend darüber.
Das durch sie dokumentierte Geschehen setzte schon Wochen vor dem Brand ein, und zwar damit, dass eine aus Oberndorf am Neckar stammende Magd eine Stelle beim Schiltacher Wirt und Schultheiß Jakob Schörnlin antrat. Wenig später begann es in dessen am Marktplatz gelegenen Wirtshaus zu spuken, die Rede ist von einem „Gespenst“, das die Hausbewohner mit Pfeifen, Trommeln und allerlei Schabernack narrte, jedoch unsichtbar blieb. Schörnlin holte einige „Gesellen“ zu Hilfe, doch wurden weder sie, noch die Pfarrer von Schiltach und Schenkenzell, die den Exorzismus anwandten, des Phänomens Herr. Es soll ihnen jedoch zu verstehen gegeben haben, dass es „der Teufel“ sei. Sein Tag und Nacht zu vernehmendes Rumoren hörte erst auf, als Schörnlin am 29. März die Magd entließ und sie nach Oberndorf zurückschickte.
Nach elftägiger Pause fing am 10. April, Gründonnerstag, die „Gugelfuhr“ im Wirtshaus jedoch erneut an, verbunden mit der Drohung, dass bald das ganze Städtchen „bis auf den Boden verbrannt“ sei. Tatsächlich gingen an jenem Tag alle 17 Häuser der Schiltacher Kernstadt um den Marktplatz durch Feuer zu Grunde, und die etwa 120 Einwohner verloren Hab und Gut.
Bei der Suche nach der Ursache des Brands fixierten sich die vor dem Nichts stehenden Bürger auf die Spukerscheinung zwei Wochen zuvor und damit auf Schörnlins frühere Magd: Sie wurde zur Schuldigen erklärt, zumal sich Stimmen erhoben, die sie am Morgen des Brands in Schiltach gesehen haben wollten. Eilige Nachfragen in Oberndorf ergaben jedoch, dass sie zur gleichen Zeit dort in der Kirche gewesen und zu den Sakramenten gegangen war. Der Widerspruch wurde damit aufgelöst, dass man ihr einen Flug auf einer Ofengabel von Oberndorf nach Schiltach und zurück unterschob. Diese Vorstellung stammt aus dem Glauben an die Existenz von „Hexen“, denen der Teufel höchstpersönlich die Fähigkeit zum „Hexenflug“ verlieh.
Von diesem, vom abgebrannten Schiltach ausgehenden „Geschrei“ (Zimmerische Chronik) war die Oberndorfer Obrigkeit so beeindruckt, dass sie die Frau, deren Name nicht überliefert ist, am 11. April, Karfreitag, in Haft nahm. Da diese auch kein unbeschriebenes Blatt war - vor Jahren soll sie bereits, zusammen mit ihrer Mutter, „ des Hexenwerks verdächtig“ gewesen sein - stand ihre Schuld von vorne herein fest. So konnte es nur noch darum gehen, von ihr ein Geständnis zu bekommen, was auf gütlichem Weg jedoch nicht gelang, da sie ihre Unschuld beteuerte. Sie wurde der Folter unterzogen und gestand nun alles, was man, im Sinne der Hexenlehre, von ihr hören wollte: dass sie die Brandstiftung durch Umschütten eines Topfs auf Befehl des Teufels bewerkstelligt habe; dass sie dessen langjährige Buhlin gewesen sei, und dass er ihr auch den Flug auf der Ofengabel ermöglicht habe.
Damit waren alle Bestandteile des Hexereidelikts, der Teufelspakt, der Schadenzauber, die Teufelsbuhlschaft und der Hexenflug, beisammen und wurden als „Urgicht“ dem Oberndorfer Stadtgericht vorgelegt, das dafür nur die Todesstrafe verhängen konnte. Die letzte Entscheidung stand dem Stadtherrn zu, dem Freiherrn Gottfried Werner von Zimmern, der eigentlich vor der Verfolgung von Hexerei „Abscheu empfand“. Doch auch er konnte nicht anders, als das Todesurteil zu bestätigen: „Er hat sie lassen verbrennen“, was am 21. April 1533 zu Oberndorf geschah. Die geschockten Oberndorfer aber machten, um eine Katastrophe wie in Schiltach abzuwenden, eine Prozession um die Stadt und baten „Gott um Gnad“.
Doch war damit die Sache noch nicht zur Ruhe gekommen: Es erhob sich ein erneutes „Geschrei“, nämlich dass in Ingolstadt ein „Schwarzkünstler“ gestanden habe, dass er „der Geist (war), der das Städtlein verbrannte“(Zimmerische Chronik). Dazu sind in Ingolstadt leider keine Akten überliefert, und die darüber berichtenden Chronisten lehnen, ihrerseits im Hexenglauben befangen, diese Nachricht als unwahr ab. Mit hoher Wahrscheinlichkeit aber führt gerade sie auf den Grund der Schiltacher Ereignisse: Mit ihr wird vorstellbar, dass der Spuk im Wirtshaus von einem von der Magd dort versteckten Vaganten veranstaltet wurde, als Ulk oder Posse, oder, weil er ihr gegen den Wirt und seine Nachstellungen helfen wollte. Nach ihrer Kündigung und Ausweisung rächte er sich mit der Brandstiftung, der, vielleicht unbeabsichtigt, das Städtchen insgesamt zum Opfer fiel. So gesehen, hatte der „Teufel von Schiltach“ keine dämonischen, sondern auf zwischenmenschlicher Ebene anzusiedelnde Ursachen.
2 Die Wirkungen
Einige Zeit danach erzählten Schiltacher Bürger das Geschehen im Rat der Stadt Freiburg, vielleicht als Delegation, die um Hilfe bat. Ihr Bericht kam dem Humanisten Erasmus von Rotterdam zu Ohren, dem seinerseits eine Anfrage aus Antwerpen wegen der landauf landab als Sensation gehandelten Ereignisse in Schiltach vorlag. In einem in Freiburg auf Latein verfassten Brief vom 25. Juli 1533 schilderte Erasmus ausführlich, was ihm darüber zugetragen worden war: Als „Tatsache“ hielt er fest, dass „das ganze Städtchen plötzlich in Flammen aufging, und dass eine Frau aufgrund ihres Geständnisses hingerichtet wurde“; als „Gerücht“, dass dabei ein „Dämon“ die Hände im Spiel gehabt habe, was sich aber so hartnäckig halte, „dass es nicht als erfunden betrachtet werden kann.“
Diese Äusserung des berühmten Gelehrten sollte ungeheure Wirkung entfalten: Bald gedruckt, wurde sie von den Dämonologen, den Begründern und Befürwortern der strafrechtlichen Verfolgung von Hexerei entdeckt. Sie nahmen sie als ein durch die Autorität des Erasmus verbürgtes Beispiel dafür, dass Hexen „nicht nur die Seele, sondern auch Körper, Häuser und Städte in Brand setzen können“ (Martin Del Rio, spanischer Jesuit, 1599). So wurde der „Teufel von Schiltach“ noch mehr als 150 Jahre lang, bis zum Ende der Hexenverfolgungen, in Europa und sogar im kolonialen Nordamerika zitiert, wann immer es um Beweise dafür ging, dass schadenzauberische Hexen Katastrophen auslösen können.
Diesen Fall ließen sich auch protestantische Theologen nicht entgehen, die, wie der Jenaer Professor Job Fincel, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts „Wunderzeichen- und Exempelbücher“ herausbrachten. Für sie waren die Schiltacher Ereignisse ein Paradebeispiel für „des Teufels Gewalt und Bosheit“, der sich vor dem drohenden Weltende nochmals austobte. Zugleich wurde der „Teufel von Schiltach“ sprichwörtlich, den man zitierte, „so man von einer erschrockenlichen Tat sagen will“ (Zimmerische Chronik). Einen literarischen Beleg dafür liefert der Straßburger Dichter Johann Fischart: „Hey, dass dich der Teufel zu Schiltach hol“ (1575).
Auch in Schiltach war die Sache mit dem Teufel noch lange nicht ausgestanden: 1591 wurde, nach einem neuerlichen Stadtbrand im Jahr zuvor, eine Frau namens Brigita Dieterle „als ein Hex verbrant“. Bis 1631 kostete der Hexenglauben in Schiltach neun weiteren Frauen das Leben, und in der Bevölkerung kamen noch bis um 1700 Hexereibeschuldigungen auf.
Auch danach lebte der „Teufel von Schiltach“ weiter: Einerseits fand er Eingang in die Geschichtsschreibung, die nach rationalen Erklärungen suchte; andererseits wurde er zur Gruselgeschichte aus alter Zeit - ein Fundstück für Sagensammler, Literaten und Künstler. So nahmen die Brüder Grimm die Schiltacher Ereignisse unter dem Titel ‚Des Teufels Brand‘ in ihre ‚Deutschen Sagen‘ (1816) auf. Auch Ludwig Bechstein verfasste für sein ‚Deutsches Sagenbuch‘ (1853) einen ‚Teufel in Schiltach‘, auf der Grundlage eines der Flugblätter von 1533. Daraus machte er unter dem Titel ‚Teufelsbuhlschaft‘ auch eine seiner sechs ‚Hexengeschichten‘, mit einer deutlichen Stellungnahme gegen die Hexenverfolgungen. Der Stoff blieb auch Wilhelm Jensen, einem Vielschreiber historischer Erzählungen, nicht verborgen: 1883 erschien sein breit angelegter Roman ‚Der Teufel in Schiltach‘.
Die jüngste Adaption ist der im Auftrag des Südwestrundfunks 1984 gedrehte Fernsehfilm ‚Chronik vom Brand der Stadt Schiltach im Kinzigtal anno 1533‘ des Regisseurs Frank Wesel. Zwar in verfremdeter Landschaft und Örtlichkeit spielend, hält er sich doch an das aus den Quellen zu erschließende Geschehen, das er als ein aus Aberglauben, Nachstellungen, Intrigen und Rache gespeistes Drama interpretiert.
In Schiltach hielten im 20. Jahrhundert die Künstler Karl Eyth und Eduard Trautwein die Erinnerung an den „Teufel von Schiltach“ wach, der hier seit 1942 auf einem Fresko am Rathaus (siehe Abbildung 2 auf Seite 8) auch öffentlich erscheint. Davon ließ sich die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene Narrenzunft inspirieren, als sie nach einer ortsgeschichtlichen Anbindung für eine Fastnachtsfigur suchte: Unter Hinweis auf die Ereignisse von 1533 schuf man den „Schiltacher Teufel“ und stellte ihm die „Magd“ zur Seite; beide Masken gehören mittlerweile zum fastnächtlichen Brauchtum, das sich verselbständigt hat und nicht auf seine historischen Hintergründe befragt wird. Dies gilt auch für die laufend erscheinenden, sich geheimnisvoll gebenden Sammlungen regionaler Sagen- und Spukgeschichten, in denen der „Teufel von Schiltach“, meist in der Fassung der Brüder Grimm, nicht fehlen darf.
Literatur
[1] Dr. Hans Harter, Der Teufel von Schiltach. Ereignisse – Deutungen – Wirkungen. Mit einer Quellendokumentation, Stadt Schiltach (Hg.), Schiltach 2005 (Beiträge zur Geschichte der Stadt Schiltach Bd. 2), Online: http://www.historicum.net
[2] Ergänzungen bei: Arbeitskreis interdisziplinäre Hexenforschung. Mailingliste: http://www.listserv.dfn.de
[3] Eine der Flugschriften ist bei der Bayerischen Staatsbibliothek München digitalisiert: http://www.digitale-sammlungen.de/ db/bsb00006348/images/